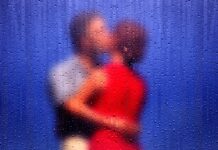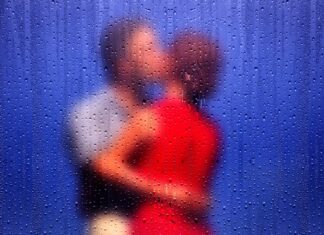Seit über 65 Jahren baut die Emilio Stecher AG am Rooterberg Sandstein ab. Vergangene Woche lud sie Architekturfachleute zur Besichtigung mit Live-Sprengung ein.
Laut dem Historischen Biographie-Lexikon wird am Rooterberg schon seit rund 300 Jahren Sandstein abgebaut – seit langem bereits nach strengen Auflagen von Bund und Kanton. Eingesetzt wird dieser begehrte Naturstein im sakralen und gepflegten Innenausbau, im Restaurations- und Renovationsbereich von Museen, Schlössern und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden sowie im Gartenbau, für Treppenplatten, Mauersteine usw. Das bekannteste Bauwerk aus Rooterberger Sandstein ist das Löwendenkmal in Luzern. Im Luzerner Regierungsgebäude bestehen die Bodenbeläge und die Treppen aus dem Material, das als zurückhaltend gediegen gilt und nun von innovativen Architekten neu entdeckt wird. Entsprechend gross war denn auch das Interesse, als die in Root domizilierte Emilio Stecher AG in ihren Steinbruch Wiesweid am Rooterberg, hoch über der Gemeinde Root mit herrlichem Ausblick übers Rontal, einlud.
Sandstrand wird abgebaut
Zum Auftakt der interessanten Führung gab Emilio Stecher, Verwaltungsratspräsident und Inhaber des 1944 von seinem Grossvater gegründeten Unternehmens, einen kurzen Einblick in die geologischen Gegebenheiten. Er erinnerte daran, dass einst bei uns subtropisches Klima geherrscht und sich vom Boden- bis zum Genfersee ein schöner Sandstrand erstreckt hatte. Was nun am Rooterberg, dem letzten Sandsteinbruch der Innerschweiz, abgebaut werde, sei eigentlich nichts anderes als dieser Sandstrand in versteinerter Form.
Grösse Blöcke sind das Ziel
Täglich finden im Steinbruch, der seit 1964 der Firma Stecher gehört, Sprengungen statt. Ziel ist es, möglichst grosse Blöcke mit einem Gewicht von zehn bis 15 Tonnen zu erhalten, die man nachher zum Beispiel für Türeinfassungen oder andere grössere Gebäudeelemente verwenden kann. Während früher die Abbauverfahren noch weitaus aufwendiger waren und die Steine nur von Anfang November bis Ende März auf Schlitten ins Tal befördert werden konnten, ist heutzutage vieles einfacher. Für alle Arbeitsschritte stehen moderne Geräte zur Verfügung; der Transport erfolgt ebenfalls zeitgemäss per Lastwagen. Und aus Root, das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Metropole der «Sandsteinbrüchler» war, ist längst eine moderne Gemeinde geworden.
Aufschlussreiche Einblicke
Zeitgleich mit Emilio Stechers Ausführungen bereiteten seine Leute im Hintergrund die im Programm angekündigte Live-Sprengung vor: Nachdem die notwendigen Löcher gebohrt und die Sprengschnüre gelegt sind, kommt noch Wasser in die Löcher, um die Wirkung zu erhöhen. Alle Teilnehmenden warten gespannt auf den grossen Moment. Und kaum ist das Hornsignal verklungen, knallts; für einen kurzen Moment nebelt eine riesige Staubwolke den Steinbruch ein. Dass in der zwischen 1870 und 1880 erbauten Steinhauerhütte am offenen Feuer noch mehrmals pro Jahr Eisen für die Sprengungen geschmiedet werden, erlebten die Teilnehmenden der Besichtigung ebenfalls live mit. Schliesslich konnten sie noch zuschauen, wie Sandstein gespaltet und Mauersteine gebrochen werden, bevor Produktionsleiter Guido Walliser zeigte, wie die Steine in der Architektur, zum Beispiel für Fassaden oder im Innenausbau, eingesetzt werden. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer kleinen Kostprobe von Bildhauer und Plastiker Rafael Häfliger, der am Objekt vorführte, wie er den Sandstein künstlerisch bearbeitet.

Bild shab

Bild shab