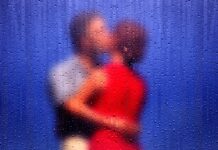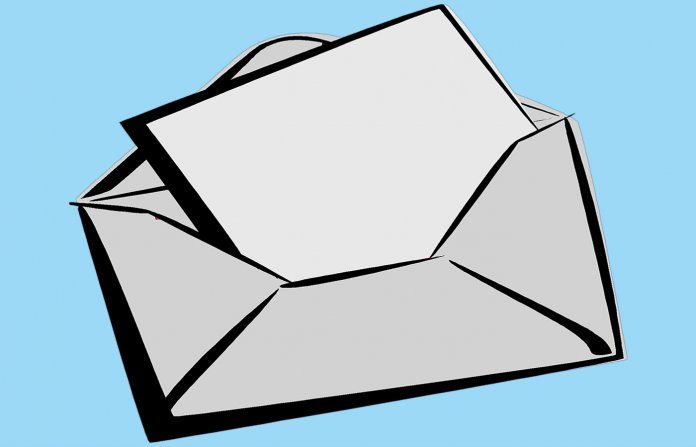Führt das Personalgesetz zu Status-Einbussen von Pfarrpersonen?
Im Vorfeld der Abstimmung «Personalgesetz der Reformierten Kirche» wird argumentiert,
dass Pfarrpersonen ihren Status verlieren könnten. Klar haben Pfarrpersonen besondere, wichtige Aufgaben wahr zu nehmen. Nebst der christlichen Verkündigung, sollen sie auch solidarisch für nicht privilegierte Mitmenschen einstehen. Mit dem Kirchenvorstand als verantwortliches Wahlgremium, könnten Pfarrpersonen vor Repressalien besser geschützt werden, z.B. wenn sie «unpopuläre Themen» vertreten müssen. Das von der Synode mit grosser Mehrheit angenommene Gesetz regelt die Anstellungsbedingungen aller kirchlichen Mitarbeitenden, ohne die Würde der Pfarrer zu schmälern. Auch mit dem neuen Gesetz behalten Pfarrpersonen ihre besondere Stellung: Sabbatical, Mitglied des Kirchenvorstandes von Amtes wegen, Berufsgeheimnis wahren etc. Mit dem Ja zum neuen Personalgesetz stimmen wir auch zu, dass Pfarrpersonen in Konfliktsituationen geschützt und unterstützt werden können. Aus diesen Gründen stimme ich dem zeitgemässen Personalgesetz aus Überzeugung zu.
Hannes Kocher, Udligenswil
Ehemaliger Kirchenpflege Präsident
Ein Ja für das neue Personalgesetz
Erinnern sich an den Tag, an dem Sie einen neuen Pfarrer wählten? Eine echte Wahl hätten Sie ohnehin keine, denn der Kirchenvorstand wählt vorgängig die Pfarrperson aus und schlägt ihnen eine Einer Kandidatur vor. Das neue Personalgesetz regelt dieses bewährte Verfahren und geht sogar noch einen Schritt weiter, indem es verlangt, dass die Mitglieder der Kirchgemeinde in die Auswahl der Pfarrperson einbezogen werden müssen. Interessierte Mitglieder können sich also für die Auswahl der bestgeeigneten Person engagieren, statt dass Sie einer kaum bekannten Person die Stimme geben oder verweigern. Die Synode hat bewusst auf die nachteilige Volkswahl verzichtet und die
Kann-Vorschrift von §50/3 der Kirchenverfassung nicht umgesetzt. Es ist eine perfide Verdrehung der Wahrheit, dass das Neue Personalgesetz ein Totalverbot der Pfarrwahl für immer festlegt. Mit einer Initiative kann man darauf zurückkommen und Volkswahlen verlangen. Deshalb ein überzeugtes Ja für das fortschrittliche Personalgesetz.
Max Kläy, Meggen
Ein klares JA zum neuen Personalgesetz der reformierten
Kirche des Kantons Luzern
Im aktuellen gesellschaftlichen Umfeld ist die Auswahl einer Pfarrperson eine höchst
anspruchsvolle Aufgabe. Neben Erfahrungen aus bisherigen Pfarrämtern und theologischer Fachkompetenz muss eine Kandidatin/ein Kandidat sich mit der spezifischen Situation und den Zielen der Kirchgemeinde identifizieren können, sich seelsorgerisch engagieren sowie kooperativ mit dem Kirchenvorstand und dem Team der kirchlichen Mitarbeitenden zusammenwirken. Es ist sinnvoll, die seriöse Beurteilung und Gewichtung dieser eng miteinander verknüpften fachlichen und persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen einer
Pfarrwahlkommission zu übertragen, in welcher neben demokratisch gewählten Kirchenvorständen Gemeindemitglieder mitwirken, welche Erfahrung in der
Besetzung von Schlüsselpositionen haben. Die Verantwortung für die Anstellung und
für dieTrennung von Pfarrpersonen kann und soll nicht dem Kirchenvolk aufgebürdet
werden. Deshalb ist ein JA zum neuen Personalgesetz die richtige Entscheidung.
Willy Toggwyler, Udligenswil
Ein klares Nein
Das neue Personalgesetz der Reformierten Kirche, verbietet der Kirchgemeinde, die
Pfarrerin oder den Pfarrer zu wählen. Es überträgt diese Kompetenz dem Kirchenvorstand.
Das Gesetz wurde vom Synodalrat ausgearbeitet. Die Synode winkte es durch. Der Abbau
demokratischer Rechte schien niemanden zu stören. Das Personalgesetz sollte nach dem
Vorbild des Kantons gestaltet werden. Damit wird der einmalige Charakter der Kirche
verkannt. Sie ist mehr als ein Unternehmen, das Dienstleistungen erbringt (Gottesdienst,
Taufen, Zeremonien bei Eheschliessungen und Todesfällen). Sie hat ihren Grund in Jesus
Christus. Mit dem Verstand lässt sich das nicht begreifen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer
haben den Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Ihr Amt lässt sich nicht mit dem Pflichtenheft einer Buchhalterin, eines Sigristen oder einer Katechetin vergleichen.
Bei der 1. Lesung stellte das Pfarrkapitel den Antrag, einen Paragrafen ins Personalgesetz
aufzunehmen, der die Volkswahl weiterhin ermöglicht hätte. Doch dieser Antrag wurde von
der Synode abgeschmettert. Es gab Synodale, welche die theologischen Argumente der
Pfarrschaft in Zweifel zogen und ihnen niedere Motive unterschoben, wie die Angst vom
Sockel gestossen zu werden. Ein dümmeres Motiv lässt sich kaum vorstellen. Die 68er
Bewegung hat alle vom Sockel geholt. Wer heute den Beruf einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers ergreift, ist ein modern denkender Mensch, der neben starken Wurzeln im Glauben
über soziale Kompetenzen verfügt. Die Bereitschaft den Mitmenschen auf Augenhöhe zu
begegnen, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Gegen das Verbot der Volkswahl gibt es Opposition. Das Referendumskomitee «Pro Volkswahl – NEIN zum Personalgesetz» verlangt, dass für Wahlen und Entlassungen von Pfarrpersonen weiterhin die Kirchgemeindeversammlungen zuständig bleiben. Der Antrag des Pfarrkapitels muss in das neue Personalgesetz aufgenommen werden. Die reformierte Tradition darf nicht ohne triftigen Grund geändert werden. Das Komitee hat innerhalb eines Monats fast elfhundert Unterschriften gesammelt. Es empfiehlt am 9. Dezember ein überzeugtes Nein.
Alexander Boerlin, Synodaler
Ein Zonenplan der alles verschlimmert…
…anders kann man es wohl nicht sagen. Der neue Zonenplan sieht vor, dass auf der Hangkante der Wiesterrasse, 3 mächtige Bauklötze gebaut werden. In einem Gebiet das als Gefahrenzone galt, (Rutschgefahr ) wird nun zur spez. Wohnzone. Zur Hochspannungsleitung wird ein min. Abstand von nur 49 m gegeben. Den Bewohnern würde nebst der Sicht, auch noch während den Wintermonaten die Sonne genommen. So wie das Quartier jetzt mit Einfamilienhäusern bebaut ist, ist es nicht noch nötig, hier überdimensionale Blöcke hinzustellen. Ich glaube in der Gemeinde Root hat es mittlerweile
genug Betonblöcke und weitere werden ja noch im Dorf gebaut. Es scheint, als wolle der jetzige Gemeinderat sich ein Exempel statuieren, um möglichst schnell und viel zu überbauen. Ihr Ziel ist, in ca. 10 Jahren 5500 Einwohner zu haben. Verdichtetes Bauen ist angesagt. Was hat wohl die nächste Generation für Möglichkeiten um sich ein Eigenheim zu leisten? Wohl keine mehr.
H. Häusler, Root
Selbstbestimmungsinitiative
In der totalrevidierten Bundesverfassung vom 18. April 1999 wurde – wie schon in der Verfassung von 1874 – darauf verzichtet, das Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht zu regeln. Somit wurde es den Gerichten, namentlich dem Bundesgericht, überlassen im Einzelfall gesetzgeberische Abweichungen von bestehenden völkerrechtlichen Verträgen zu bestätigen, wenn das Gericht feststellte, dass der Verfassungs- oder Bundesgesetzgeber dies bewusst in Kauf genommen hatte. Es käme wohl niemandem in Sinn, dem Bundesgericht deswegen vorzuwerfen, es habe damit einen „Frontalangriff auf die Menschenrechte“ verübt. Die Gegner der Selbstbestimmungsinitiative behaupten stets, es sei offensichtliches Ziel der Inititative die Menschenrechtskonvention aufzukündigen. Das kann weder der Initiative entnommen, noch dem Bundesgericht unterstellt werden, wenn es dem Landesrecht den Vorrang gegenüber Völkerrecht einräumt.
Reto Frank, SVP Kantonsrat, Meggen
Für die Sicherheit von Mensch und Tier
Seit den 1970er Jahren tragen fast keine Kühe Hörner mehr. Der Grund ist einfach: In der Landwirtschaft ist man davon abgekommen alle Kühe im Stall anzubinden und man hat Freilaufställe gebaut. Im Freilaufstall können sich die Tiere frei bewegen – eine tierfreundlichere Haltung wurde damit ermöglicht. Durch die freiere Bewegung erhöhte sich aber auch die Verletzungsgefahr für Mensch und Tier. Ein Hornstoss ist eine gefährliche Angelegenheit. Deswegen ist die Enthornung oder die Züchtung hornloser Kühe zu einer bewährten Praxis geworden.
Die Hornkuh-Initiative will in die Verfassung schreiben, dass Bauern für die Haltung von horntragenden Kühen finanzielle Unterstützung erhalten. Verfolgt man die Äusserungen der Initianten, so stellt man fest, dass es vorwiegend um die Schmerzen der Tiere bei der Enthornung geht. Ich frage mich, warum sie dann nicht explizit ein Verbot verlangen. Die Initiative führt dazu, dass Bauern vom Freilaufstall zum Anbindestall zurück wechseln. Genau das wollen wir nicht mehr.
Jede Bäuerin und jeder Bauer sollen in Eigenverantwortung selber entscheiden können, ob ihre Kühe oder Ziegen Hörner haben sollen oder nicht. Ich will die Bürokratie für die Landwirtschaft abbauen und nicht noch mehr ausbauen. Deshalb stimme ich am 25. November 2018 NEIN zur Hornkuh-Initiative.
Albert Vitali, Nationalrat FDP, Oberkirch
Fehlender Mut
Gemäss der Präsidentin der SVP Kanton Luzern ist die Selbstbestimmungsinitiative (SBI) die wichtigste Abstimmungsvorlage der letzten 25 Jahre. Die Kampagne der Befürworter bestätigt diese Wichtigkeit nicht. So wird das CVP-orange für Werbung zur Initiative verwendet. In den Inseraten verzichtet die Präsidentin der SVP sowohl auf die Erwähnung ihrer Präsidialfunktion wie auch auf ihre Partei. Hat sie wohl den Mut für die Initiative verloren? Oder will man damit bewusst die Stimmbürger hinter das Licht führen? Demokratie ist auch in einer Abstimmungskampagne auf Vertrauen aufgebaut. Das gilt auch bei der SBI. Ich lasse mich nicht hinter das Licht führen und sage Nein zur SBI.
Rico De Bona, a. Grossrat / a. Gemeinderat, Littau/Luzern