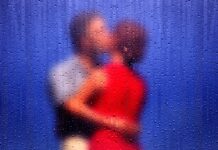Nach zehn erfolgreichen Jahren mit europäischer Ausrichtung wird der Schindler Award 2015 erstmals weltweit ausgetragen. Das ist kein Zufall, denn in einer zunehmend vernetzten Welt sind globale Antworten auf die künftigen Herausforderungen in urbanen Zentren gefragt.
Im Rahmen des Global Schindler Award erhalten angehende Architektinnen und Architekten sowie Städteplanerinnen und Städteplaner die Möglichkeit, ihre Vision einer renommierten Jury zu präsentieren und ihre interdisziplinären Lösungsansätze mit dem begehrten Award auszeichnen zu lassen. Angesprochen sind Studierende im letzten Bachelor-Jahr bzw. in einem Master-Studiengang, und neben viel Applaus und Anerkennung winken auch handfeste Preise.
Von der beschaulichen Schützenmatte ins pulsierende Pearl River Delta
Bei der letzten Austragung des Schindler Award im Jahr 2012 waren die Studierenden dazu eingeladen, sich mit dem Areal Schützenmatte am Rande der Berner Altstadt auseinanderzusetzen, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. 2015 wartet nun eine völlig andere Aufgabe auf das internationale Teilnehmerfeld, denn das diesjährige Wettbewerbsareal befindet sich in der pulsierenden chinesischen «Future City» Shenzhen. Die beispiellose Wachstumsgeschwindigkeit dieser Grossstadt führt dazu, dass Prozesse wie Verdichtung, Erweiterung sowie Ausbau und Erneuerung der Infrastrukturen simultan ablaufen. Das stellt höchste Anforderungen an die urbane Mobilität. Nicht nur in Shenzhen selbst, sondern in allen Wachstumszentren weltweit. Die im Rahmen des Global Schindler Award präsentierten Lösungsansätze sollen sich deshalb auch in einem globalen Kontext anwenden lassen. Hierfür wurde die Aufgabenstellung von einem Team der ETH Zürich im Rahmen eines Forschungssemesters eingehend diskutiert und entsprechend präzisiert.
Ausgewiesene Experten im Hintergrund
Um herausragende Projekte gebührend würdigen zu können, braucht es für deren Bewertung natürlich auch ausgewiesene Experten für Städtebau. Deshalb wird die Jury bei ihrer Arbeit von Professor Kees Christiaanse unterstützt, der sich seit mehr als 30 Jahren mit der Thematik auseinandersetzt.
Christiaanse leitet das Institut für Städtebau an der ETH Zürich sowie das Future Cities Laboratory in Singapur, welches ebenfalls als Partner des Global Schindler Award auftritt. Gemeinsam mit seinem Team, rund um Myriam Perret, die als Forschungs- und Lehrassistentin für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich arbeitet, war Christiaanse für das gesamte Competition Management verantwortlich. Projektleiterin Andrea Murer von Schindler ist überzeugt, dass sich der grosse Aufwand für den Award längerfristig auszahlt: «Die Entwicklung von nachhaltigen und effizienten Mobilitätskonzepten zählt zu den wichtigsten globalen Herausforderungen der Zukunft. Mit diesem Wettbewerb motivieren wir junge Talente dazu, sich möglichst ganzheitlich mit der Problematik auseinanderzusetzen.»
Preisgekrönte Projekte – vielversprechende Talente
Die wichtigste Herausforderung des nächsten Global Schindler Award sieht Kees Christiaanse im Umgang mit schnellen Urbanisierungsprozessen, die nach hoher Dichte und nachhaltigen Städtemodellen verlangen. Vom Wettbewerbsstart im August 2014 an bleiben den Teilnehmenden rund sechs Monate Zeit, um ihre Lösungsansätze in Form eines Gesamtprojekts einzureichen. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema «urbane Mobilität» soll sich am Ende auch auszahlen. Einerseits für die untersuchten Zentren, die wertvolle Impulse für die nächsten Entwicklungsschritte erhalten, andererseits auch für die Studierenden selbst. Neben dem beachtlichen Renommee, das mit dem Gewinn eines solchen Awards verbunden ist, warten Sachpreise im Gesamtwert von rund CHF 120‘000.– auf sie. Ausserdem werden die Urheber der ausgezeichneten Projekte mit ihren Lösungen für die Mobilitäts-Probleme von „Future Cities“ sicher auch auf das Interesse von internationalen Architektur- und Städteplanungsbüros stossen, welche stets auf der Suche nach den Talenten von morgen sind.
Der Global Schindler Award ist eine Partnerschaft zwischen der Schindler-Gruppe, der ETH Zürich und dem Future Cities Laboratory.