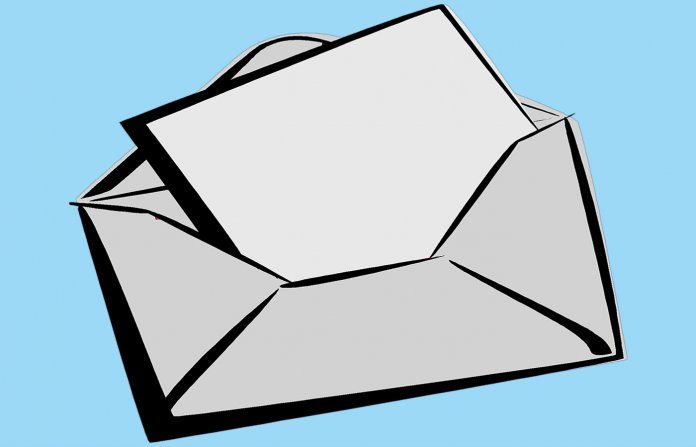Wohnen ist ein Grundbedürfnis
Wohnen ist ein Grundbedürfnis – aber für immer mehr kaum mehr bezahlbar. Für immer mehr Familien mit tiefen und mittleren Einkommen und Rentnerinnen und Rentner im Kanton Luzern sind die Mietpreise zu hoch, sie müssen mehr als ein Viertel ihres Einkommens für die Wohnung aufwenden. Der sehr tiefe Leerwohnungsbestand ist ein zusätzlicher Preistreiber. Die wenigen freien Wohnungen sind oft sehr teuer und/oder entsprechen nicht den Raumbedürfnissen der Suchenden. In gewissen Gemeinden und Regionen ist es fast unmöglich für diese Menschen, eine zahlbare Wohnung zu finden. Wer sich eine teure Wohnung leisten kann, wohnt in der Stadt, der Agglomeration oder in den steuergünstigen Gemeinden. Wer nur tiefere Miete bezahlen kann ist gezwungen, aufs Land zu ziehen und muss unter Umständen seine gewohnte Umgebung unfreiwillig verlassen. Die Initiative «Bezahlbares Wohnen für alle» will eine weiterhin gute soziale Durchmischung der Bevölkerung in allen Regionen des Kantons fördern. Genossenschaftswohnungen sind bis 25 Prozent günstiger als Wohnungen auf dem freien Markt. Deshalb soll der Kanton sein Bauland, welches sich für Wohnraum eignet, an Wohnbaugenossenschaften mit gemeinnützigem Charakter oder Gemeinden, welche bezahlbaren Wohnraum unterstützen möchten, verkaufen oder im Baurecht abgeben. Luzern hat schon verschiedene Genossenschaften, sie sollen durch diese Massnahmen einfacher zu Bauland kommen. Zudem soll ein Fonds errichtet werden, für Darlehen an diese Wohnbaugenossenschaften, z.B. damit grössere Projekte finanziert werden können. Vergleichbar ist dieser Fonds mit den Geldern der landwirtschaftlichen Kreditkasse für Bauten in der Landwirtschaft. Dieses Geld ist nicht verloren sondern wird mit Zinsen dem Kanton zurückbezahlt. Der Kanton muss hier seine Verantwortung besser wahrnehmen, genauso wie verschiedene Gemeinden, welche bezahlbares Wohnen ebenfalls aktiv fördern. Deshalb braucht es am 4. März ein klares Ja!
Yvonne Zemp Baumgartner, SP Kantonrätin, Sursee
Die Aufgabe wahrnehmen
Die Volksinitiative «Zahlbares Wohnen für alle» will der Wohnungsnot und den steigenden Mietpreisen im Kanton wirksam entgegentreten. Denn trotz leerer Wohnungen ist es für wohnungssuchende Familien oder auch die ältere Generation immer schwieriger, eine zahlbare Wohnung zu finden. Genossenschaften sollen deshalb gezielt unterstützt werden. Denn trotz Bauboom in vielen Regionen sinkt der Anteil genossenschaftlicher Wohnungen immer mehr. Die Mieten bei Genossenschaften sind jedoch im Schnitt 20 Prozent günstiger und der Anteil Familienwohnungen liegt deutlich höher als im restlichen Wohnungsmarkt. Die Luzerner Bevölkerung hat die Probleme erkannt und verlangte mit wohn- und bodenpolitischen Initiativen schon in Emmen, Hochdorf, Horw, Kriens, Luzern, Rothenburg und Sursee eine neue, zukunftsgerichtete Wohnpolitik. Nun ist es an der Zeit, dass auch der Kanton seine Aufgabe wahrnimmt und Gemeinden und gemeinnützige Wohnbauträger unterstützt.
Jörg Meyer, SP-Kantonsrat, Adligenswil
Nein zur kostspieligen Wohnbauinitiative
Am 4. März stimmen wir über die Initiative «Zahlbares Wohnen für alle» ab. Damit werden einmal mehr unnötige finanzielle Forderungen an den Kanton gerichtet. Die Initiative verlangt jährlich 11 Millionen Franken für den gemeinnützigen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Die schon lange Zeit anhaltende Tiefzinsphase ermöglicht gute Konditionen für die Wohnbaugenossenschaften, ohne dass der Staat in ein funktionierendes System eingreifen muss. Zudem wird der Gemeinnützige Wohnungsbau heute schon vom Kanton bei der Vergabe von Wohnbauland unterstützt. In der angespannten finanziellen Situation des Kantons Luzern macht es wenig Sinn, jährlich zusätzliche 11 Millionen Franken zweckgebunden für etwas bereitzustellen, wozu kaum Bedarf besteht. Aus diesen Gründen hat sich auch die grosse Mehrheit des Kantonsrates (88 gegen 23 Stimmen) klar gegen die Volksinitiative ausgesprochen.
Georg Dubach, Kantonsrat, Triengen
Eine Initiative, die schräg in der Landschaft steht
«Mehr Grundstücke und mehr Geld für den gemeinnützigen Wohnungsbau», verpackt mit dem wohlklingenden Namen «Zahlbares Wohnen für alle», tönt auf den ersten Blick gut. Beim genaueren Hinsehen erweist sich die linke Initiative als gefährlich und gleichzeitig unnötig. Gefährlich deshalb, weil sie sehr viel Geld kostet, nämlich jedes Jahr rund 11 Millionen Franken Steuergelder, die in einen Fonds fliessen. Unnötig, weil wir bereits überdurchschnittlich viele gemeinnützige Wohnungen im Kanton Luzern haben und der Leerwohnungsbestand zunimmt. Im 2014 gab es im Kanton Luzern 14’301 genossenschaftliche Wohnungen. Nur zwei Kantone, nämlich Zürich und Bern, verfügen anzahlmässig über noch mehr gemeinnützige Wohnungen. Gleichzeitig hat der Leerwohnungsbestand im Kanton Luzern 2017 einen Wert von 2’178 Wohnungen erreicht, so viele, wie schon seit 11 Jahren nicht mehr. Die weiterhin rege Bautätigkeit wird diesen Trend noch verstärken. Die Mietzinsen sind bereits unter Druck geraten und auch diese Tendenz verstärkt sich weiter, vor allem bei Neubauwohnungen. Jetzt braucht es nun wirklich nicht auch noch staatlichen Dirigismus, der in einen funktionierenden Markt eingreift!
Damian Hunkeler, Kantonsrat FDP.Die Liberalen, Luzern
Warum Ruedi Mazenauer in den Gemeinderat?
Diese Zeilen würden man ohne das grosse Engagement von Ruedi Mazenauer heute im rontaler nicht lesen können! Er hat sich vor bald sechs Jahren mit sehr viel Herzblut dafür eingesetzt, dass die lokale Wochenzeitung nicht stirbt. Es war am 18. Mai 2012, als der rontaler als «letzte Ausgabe» auch in unserer Gemeinde verteilt worden ist. «Das darf nicht passieren», findet Ruedi. Er erarbeitet ein Rettungskonzept, gründet den Verein «Zukunft Rontaler» und sucht mit seinen Mitgliedern und weiteren Leuten nach Lösungen, wie der rontaler am Leben erhalten werden kann. Es ist offensichtlich gelungen, denn schon am 16. August 2012 fanden die geneigten Leser «ihren» rontaler, der im Laufe der Zeit zudem an Profil gewonnen hat, im Briefkasten. Danke, dir Ruedi und deinen Mitkämpfern! Ruedi Mazenauer lässt seinen Worten gerne Taten folgen und ist daher die Idealbesetzung in einem Gemeindeart, der vor grossen Herausforderungen steht.
Rolf Friedrich, Ebikon
Guido Müller ist ein fundierter Politiker
Als besorgter Bürger der Gemeinde Ebikon liegt es mir und wahrscheinlich auch vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern am Herzen, wieder einen integren Gemeinderat zu wählen. Wir sind der Meinung, es sei egal, ob eine «grüner, grauer, roter oder schwarzer» gewählt wird, entscheidend für uns ist, dass es jemand ist, welcher die Mehrheit der politisch engagierten Ebikonerinnen und Ebikonern wünschen. Kürzlich haben ca. 70 Prozent eine Fusion mit der Stadt Luzern abgelehnt. Wir wünschen uns deshalb wieder einen Vertreter der Gemeinde Ebikon, welcher diese 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vertritt. Mit dem Kandidaten Guido Müller würden wir dem Wunsch der Mehrheit entsprechen. Guido Müller ist ein fundierter Politiker. Da er aber immer im Rontal ansässig war, sind ihm die Gegebenheiten Ebikons stets vertraut gewesen. Wählen wir also Guido Müller, als integere Persönlichkeit, der die Gemeinde und die Anliegen der meisten Bürgerinnen und Bürger kennt und politisch sehr engagiert ist.
Franz Küttel, Ur-Ebikoner
Finanzordnung gibt Stabilität
Für die Stabilität der Schweizer Wirtschaft und den Wohlstand der Bürger ist es enorm wichtig, dass der Bund seinen Aufgaben nachgehen kann. Dazu muss die Finanzierung gesichert sein. Dafür erhebt der Bund mit der direkten Bundessteuer, Steuern auf Einkommen und Unternehmensgewinnen. Die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer machen zusammen knapp zwei Drittel der gesamten Einnahmen des Bundes aus und sind somit die Haupteinnahmequellen. Der Bund kann beide Steuern gemäss Bundesverfassung nur bis Ende 2020 erheben. Mit der neuen Finanzordnung 2021 soll der Bund das Recht erhalten, beide Steuern bis 2035 einzuziehen. Bei einem Nein würden dem Bund umgehend 60 Prozent – über 43 Milliarden Franken – der Einnahmen wegfallen. Das würde zu einem grossangelegten Stillstand führen. Ein Ja soll jedoch kein Freipass für staatliches Ausgabenwachstum sein. Durch die zeitliche Befristung der Erlaubnis, die Steuern zu erheben, stellen wir sicher, dass der Staat auch in Zukunft hinsichtlich der Ausgaben diszipliniert werden kann. Um den Wirtschaftsstandort Schweiz ohne Rückschritt weiterhin attraktiver machen zu können und die Stabilität zu gewährleisten stimme ich Ja zur Neuen Finanzordnung 2021.
Damian Müller, Ständerat des Kantons Luzern, Hitzkirch
Ja – für gute und professionelle Medien
Das Verhalten der Billag, der geschützte und verschwenderische Stil der SRG, die Zwangsabgaben und die Untätigkeit von Bund und Parlament sorgen seit Jahren für Unzufriedenheit. Bundesrat und Parlament hatten in den letzten Jahren mehrmals Gelegenheit, Verbesserungen zu beschliessen. Stattdessen scheint der Knäuel zwischen SRG und Bundesrat zu wachsen und zu gedeihen. Es fehlt an Transparenz und in einem solch geschützten Umfeld ist es klar, dass sich «viel Fett» ansammelt. Der Kernauftrag des Staates, den Bürger zu informieren, wird von der Initiative explizit unterstützt, nicht aber «A fonds perdu»-Zahlungen. Die Aussage und das Klagen der Gegner, «Wenn Du Bürger, nicht bezahlen willst, müssen wir abstellen» ist aus unternehmerischer und politischer Sicht ungeheuerlich. Die Macht der Medien tut das ihrige dazu – womit die Frage nach reinen Profiteuren gegenüber von guten Leistungen und Verdiensten dahingestellt ist. Der Bund hat gemäss Verfassung den Auftrag, den regionalen Zusammenhalt, Bildung, Kultur, Sport und vieles mehr zu fördern. Dieser Auftrag ist nicht abhängig von der SRG oder einer Zwangsgebühr. Auch das Behindertengleichstellungsgesetz ist nicht von Art. 93 abhängig. Der Bund gibt zur Umsetzung viele Gelder aus und es ist in seiner Verantwortung, die wirkungsvollsten oder besten Mittel und Plattformen dazu zu benutzen – sprich alle Medien gleichberechtigt zu behandeln. Darüber macht die Initiative keine Vorgaben.
Die Schweizer konsumieren zu zwei Dritteln (freiwillig) ausländische Medien. Es ist nicht so, dass dies alles Pay-TV ist, im Gegenteil. Arte TV, Phönix und viele andere geniessen bei zahlreichen Bürgern einen hervorragenden Ruf und werden eben viel gesehen. Die SRG dürfte keine Existenzsicherung und Eigenmächtigkeit mit den Abgaben haben, dann würde sie sich vielleicht fragen können, was wie nötig, effizient, sinnvoll und professionell ist und was verbessert werden muss. Vielleicht würde dann der Präsident (für ca. 400 000 Franken im Jahr) sogar in der Lage sein, die Chancen und Risiken anzuschauen, zukunftsträchtige Szenarien zu entwickeln um die Zukunft der SRG langfristig sichern zu können. Also mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Plan B erarbeiten können – statt sich im Geldsegen der Zwangsabgaben zu sonnen. Diese Initiative ist unterstützungswürdig, weil sie Transparenz fordert, in die Zukunft gerichtet ist und verhindern will, dass der Staat den Bürger zum «Goldesel» macht.
Rosy Schmid, Kantonsrätin FDP.Die Liberalen, Hildisrieden
Wollen wir dem SRF wirklich den Stecker ziehen?
Die No-Billag-Initiative lässt die Emotion hochgehen. Einerseits wollen gewisse Personenkreise nur für ausgewählte Sendungen (Rosinenpickerei) bezahlen. Andererseits sorgt sie bei den Initiativgegnern für Sorgen und Ängste bezüglich einer Entsolidarisierung für unabhängige und regionale Berichterstattungen. Diese Befürchtungen sind mit Blick auf das Ausland nicht unbegründet. Dort wurden mit viel Geld TV-Stationen übernommen. Mit der Folge, dass die Berichterstattungen und Informationen nun nach Diktat der Investoren getätigt werden. Dies widerstrebt mir zutiefst! Die No-Billag-Initiative sorgt für einen Kahlschlag bei den Regionalfernsehen und den Lokalradios und die meisten Sportübertragungen könnten nur noch über Pay-TV empfangen werden. Zudem werden auf den meisten privaten TV-Kanälen hör- und sehbehinderte Menschen ausgegrenzt. Denn Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem Programmangebot müssen einen angemessenen Anteil der Sendungen in einer für hör- und sehbehinderte Menschen geeigneten Weise aufbereiten. Sei es mit Untertiteln, Gebärdensprache oder als Hörfilm. Die Kosten der aufbereiteten Sendungen werden vollumfänglich aus der Abgabe für Radio und Fernsehen finanziert. Da stellt sich schon die Frage: Wollen wir der SRF wirklich den Stecker ziehen? Die Initiative schadet mehr als sie nützt – daher lege ich ein überzeugtes Nein in die Urne!
Christine Kaufmann-Wolf, Kantonsrätin CVP, Kriens
Ja zu «No Billag»
Ich finde es bedenklich, wie gewisse Kreise wiederum schwarzmalen und Angstmacherei betreiben. Mit Annahme der Initiative werden nämlich nur die Billag-Zwangsgebühren abgeschafft, die jeder Haushalt und das Gewerbe, egal ob er das Angebot nutzt oder nicht, bezahlen muss. Bereits 2015versprach man beim Ja zum neuen Radio und Fernsehgesetz (RTVG) dem Bürger, man werde nun den Service Public neu definieren. Bis heute geschah in Bern leider nichts. Auch der Gegenvorschlag der SVP fand keine Mehrheit im Bundesparlament. Grundsätzlich bietet das SRF ja ein gutes Fernseh- und Radioprogramm an. Deshalb wird das SRF mit einem freiwilligen Abo-Angebot sowie Werbeeinnahmen auch künftig bestehen können. Vermutlich nicht mehr in diesem Ausmass und in dem Format wie heute. Für kleine und regionale Radio- und Fernsehender würden die Marktchancen dadurch aber erheblich verbessert. Mehr Medien- und Meinungsvielfalt wäre das Resultat. Von mir aus darf und muss sich die SRG neu ausrichten. Die SRG ist heute ein riesiger Staatsmoloch und ist definitiv nicht ausgewogen. Seien wir doch ehrlich, die permanenten und unterschwelligen Manipulationen und Bemerkungen gegen alles, was ihnen nicht passt, ist ideologisch geprägt. Ich will aber selber entscheiden können, was für mich ausgewogen ist, dafür brauche ich keinen linken Staatssender, der mir seine Ideologie aufdrücken will. Schlussendlich und zum Glück liegt ja auch keine kostenpflichtige Staatszeitung in meinem Briefkasten. Ohne ein Ja wird sich bei der SRG und im Leutschenbach nichts bewegen. Geben wir also der SRG die Chance und lassen mehr Medien- und Meinungsvielfalt zu. Und stimmen am 4. März Ja zu «No Billag».
Willi Knecht, Kantonsrat SVP, Geiss
Finanzieller Boden
Die No-Billag-Initiative will dem Schweizer Radio und Fernsehen den finanziellen Boden unter den Füssen wegnehmen. Es dürften keine Empfangsgebühren erhoben werden, auch eine Subvention schliesst der Initiativtext aus. Zum Erheben einer Steuer würde die Rechtsgrundlage fehlen. Und die Aussicht, dass mehr Werbeeinnahmen gewonnen werden, wenn nur noch ein Rumpfprogramm gesendet werden kann, geht gegen Null. Es ist daher nicht vorstellbar, wie der Wegfall der Gebühren finanziell aufgefangen werden könnte. Der Schaden würde sich aber nicht auf die SRG beschränken. Viele private Radio- und Fernsehstationen erhalten einen Gebührenanteil, auch bei ihnen wäre Schrumpfung oder Schliessung angesagt. In Luzern zum Beispiel Radio 3fach, aber auch das Fernsehen Tele 1. Die Information der Bevölkerung würde vor allem von privaten Interessen gesteuert, das Informationsangebot verarmen. Gleichzeitig würden Tausende von Menschen, die heute in Medienunternehmen arbeiten, ihre Stelle verlieren. Das alles ist verkehrt. Verkehrt ist schon der Name der Initiative. Im Initiativtext steht nichts von Billag. Es geht um die Zertrümmerung der SRG, des Schweizer Radios und Fernsehens. Das darf, bei aller möglichen berechtigten Kritik an einzelnen Journalisten oder Sendungen oder am vormaligen obersten Chef, nicht passieren.
Louis Schelbert, Nationalrat Grüne Luzern
Nein zu «No Billag»
Unabhängige, vielfältige Informationen und Berichterstattungen sind für die gesellschaftliche, kulturelle und politische Meinungsbildung unabdingbar. Die schädliche No-Billag-Initiative gefährdet diesen Anspruch. Deshalb stimme ich klar Nein zu «No Billag» am 4. März.
Heidi Scherer, Kantonsrätin FDP.Die Liberalen, Meggen
Sorgenkind der Kirchgemeinde ist der Kirchenrat
Begrenzung kostet Wohlstand
Die bilateralen Verträge sind eine wichtige Grundlage für unsere Handelsbeziehungen mit der EU und damit für den Wohlstand in unserem Land. Die EU ist nämlich mit Abstand unser grösster Handelspartner. Unser Handelsvolumen mit der EU ist über fünfmal so gross wie mit den USA und über zehnmal so gross wie mit China. Diesen Wohlstand will die SVP mit ihrer Begrenzungsinitiative nun aufs Spiel setzen. Denn diese Initiative würde schlussendlich zu einer Kündigung der bilateralen Verträge, welche die rechtliche Grundlage für unsere Handelsbeziehungen zur EU sind, führen. Die Bilateralen vereinfachen den Austausch von Waren ebenso wie den Verkehr der Menschen. Dank der Personenfreizügigkeit können wir die nötigen Arbeitskräfte anziehen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Die bilateralen Verträge sichern viele Arbeitsplätze und sind ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Sie leichtsinnig aufs Spiel zu setzen bedeutet, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Ich will weder einen EU-Beitritt noch eine Abschottung. Deshalb dürfen wir die Bilateralen nicht gefährden. Ich setzte mich für eine ausgewogene und stabile Beziehung mit der EU ein. Das heisst, bilaterale Verträge weiter entwickeln!
Damian Müller, Ständerat des Kantons Luzern, Hitzkirch
Sparvorschlag im Bereich Volksschule
Die Kosten pro Schüler an der Volksschule haben sich seit zehn Jahren um 27.5 Prozent erhöht. Und sie wachsen pro Kopf bis 2021 weiter um jährlich 1 Prozent. In keinem Bereich im gesamten Kantonshaushalt wachsen die Ausgaben schneller. Gleichzeitig wurde aus Kostengründen die Wochenarbeitszeit der Lehrpersonen erhöht. Wie ist das erklärbar? Ein Grund sind die viel zu kleinen Klassengrössen: Aktuell zählt eine Sek-Klasse im Durchschnitt gerade einmal 17.3 Lernende. Das vorgegebene Maximum läge aber bei gut 22 Lernenden. Flächendeckend liegen die Bestände also über 20 Prozent unter dem erlaubten Maximum. Und die Bestände sind weiter am sinken. Eigentlich würde man das Gegenteil erwarten. Denn seit Jahren versucht der Kanton, das Kostenwachstum in den Griff zu bekommen. Da stellt man sich als Laie vor, dass sich in der Folge die Bestände dem erlaubten Maximum angenähert hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Hier gibt es Handlungsbedarf. Nicht bei den Lehrpersonen und den Schülern sollte gespart werden, sondern bei der Organisation und dem System. Würde man den durchschnittlichen Bestand in der Sek nur um zwei Schüler näher ans erlaubte Maximum bringen, würden jährlich wiederkehrend rund 5 Millionen gespart. Das würde helfen, unsere weltweit bewunderte Volksschule auch in Zukunft finanzieren zu können.
Gaudenz Zemp, Kantonsrat FDP und Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern